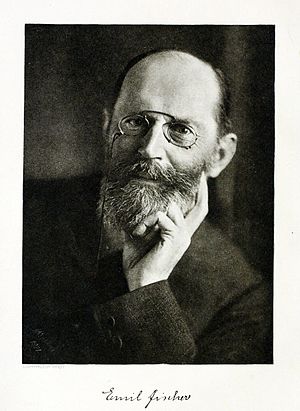Bekannt wurde er durch Arbeiten über Schmetterlinge, insbesondere Vererbungsexperimente. Er untersuchte den Einfluss der Umwelt (besonders der Temperatur, zum Beispiel Frost-Aberrationen) auf den Phänotyp (Farbe, Gestalt), die Züchtung abnormer Schmetterlingsformen (Transmutationen) und von Art-Hybriden, deren Verhalten und Eigenschaften von deren Nachkommen (F2-Generation und Rückkreuzung). Anfangs arbeitete er dabei mit Max Standfuß zusammen, dem Professor für Entomologie an der Universität Zürich und der ETH Zürich, mit dem er sich dann aber heftig zerstritt (was auch öffentlich über Veröffentlichungen ausgetragen wurde), da Standfuss der Meinung war, Fischer hätte Ergebnisse unter eigenem Namen veröffentlicht, die seiner Anregung zu verdanken waren.[1] Später veröffentlichte er mit Richard Goldschmidt (1927 über Gynander-Vererbung von Schmetterlingen).
Fischer war Lamarckist und suchte die Vererbbarkeit neu erworbener Eigenschaften (etwa von Temperatur-Aberrationen) nachzuweisen.
Transmutation der Schmetterlinge infolge Temperaturänderungen.
1895
Verknoten & Verknüpfen
Transmutation der Schmetterlinge infolge Temperaturänderungen.
1895
Experimentelle Untersuchungen über die Phylogenese der Vanessen. Friedländer und Sohn, Berlin 1895
Unbekannt
Lamarckismus ist die Theorie, dass Organismen Eigenschaften an ihre Nachkommen vererben können, die sie während ihres Lebens erworben haben. Sie ist nach dem französischen Biologen Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) benannt, der im 19. Jahrhundert eine der ersten Evolutionstheorien entwickelte. Anders als vielfach dargestellt ist die Vererbung erworbener Eigenschaften nur ein Teilaspekt von Lamarcks ursprünglicher Theorie; der Terminus Lamarckismus bezeichnet daher heute in der Regel nicht Lamarcks Theorie als Ganzes.
Während das Konzept der Vererbung erworbener Eigenschaften zunächst nicht umstritten war und sich 1859 auch in Darwins Evolutionstheorie (→ Darwinismus) wiederfand, entbrannte erst um 1883 mit August Weismanns Weiterentwicklung von Darwins Theorie[1] eine Debatte zwischen Neodarwinisten und Neolamarckisten. Dieser Streit wurde nicht allein auf wissenschaftlicher, sondern auch auf gesellschaftspolitischer Ebene bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ausgefochten. Mit der Entwicklung der Synthetischen Evolutionstheorie, in der das Prinzip der natürlichen Selektion mit der Genetik in Einklang gebracht werden konnte, wurde die Auseinandersetzung zugunsten des Darwinismus entschieden.
Während das Konzept der Vererbung erworbener Eigenschaften zunächst nicht umstritten war und sich 1859 auch in Darwins Evolutionstheorie (→ Darwinismus) wiederfand, entbrannte erst um 1883 mit August Weismanns Weiterentwicklung von Darwins Theorie[1] eine Debatte zwischen Neodarwinisten und Neolamarckisten. Dieser Streit wurde nicht allein auf wissenschaftlicher, sondern auch auf gesellschaftspolitischer Ebene bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts ausgefochten. Mit der Entwicklung der Synthetischen Evolutionstheorie, in der das Prinzip der natürlichen Selektion mit der Genetik in Einklang gebracht werden konnte, wurde die Auseinandersetzung zugunsten des Darwinismus entschieden.